Was ist Lärminduzierter Hörverlust und was sind seine Ursachen?
Seit der Industriellen Revolution und den bis heute anhaltenden technologischen Fortschritten ist das Gehör zunehmend gefährdet. Lärminduzierter Hörverlust zählt weltweit zu den häufigsten vermeidbaren Ursachen für Behinderungen. Dennoch ist das Bewusstsein in der Gesellschaft dafür nach wie vor unzureichend. Aus diesem Grund stuft die Weltgesundheitsorganisation dieses Problem als eines der vordringlichsten Gesundheitsprobleme ein.
Da es sich um eine vermeidbare Situation handelt, ist es von großer Bedeutung, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Lärminduzierter Hörverlust kann verhindert werden, bevor er auftritt; ist er aber erst einmal da, ist er bleibend. Die einzige Behandlungsmöglichkeit beschränkt sich dann auf Hörgeräte. Dies macht nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in allen anderen Branchen, insbesondere im Bereich Arbeitsgesundheit und -sicherheit, ein höheres Maß an Bewusstsein und Vorsorge erforderlich.
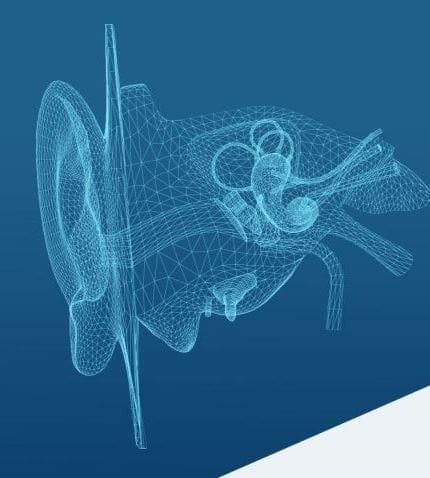

Doktor Audiologin Emel Uğur
Dr. Audiologin Emel Uğur wurde 1982 in Çanakkale geboren. Während ihrer 15-jährigen Tätigkeit am Bildungs- und Forschungskrankenhaus Istanbul arbeitete sie hauptsächlich in den Bereichen Pädiatrische Audiologie (Hörverlust bei Säuglingen und Kindern), Otologische Erkrankungen (Ohrenerkrankungen und Hörgesundheit) und Vestibuläre Systemerkrankungen (Schwindel und Gleichgewichtsstörungen). Im Jahr 2015 trat sie der Acıbadem Gesundheitsgruppe bei.
Über mich
| Ursachen | – Musikhören über Kopfhörer bei hoher Lautstärke – Ausgesetztheit gegenüber lauter Musik bei Konzerten, in Nachtclubs, Kinos und Fitnessstudios – Lärmintensive Arbeitsumgebungen wie Industrie, Baugewerbe, Fabriken – Plötzliche laute Geräusche (Waffenschüsse, Explosionen, Feuerwerk, Maschinen mit hohem Dezibelpegel) |
| Symptome | – Ohrensausen (Tinnitus) – Schwierigkeiten, Gespräche klar zu hören oder zu unterscheiden – Probleme beim Hören hoher Frequenzen – Völlegefühl im Ohr – Plötzliche oder schrittweise Abnahme des Hörvermögens |
| Art des Hörverlusts | – Vorübergehender (Schwellenverschiebung) Hörverlust: Tritt nach kurzer Einwirkung hoher Lautstärken (z. B. bei einem Konzert) auf und kann sich innerhalb einiger Stunden oder Tage wieder zurückbilden. – Permanenter (Schwellenverschiebung) Hörverlust: Bei langandauernder Lärmbelastung sterben die Zellen im Innenohr ab, was zu einem dauerhaften Hörverlust führt. |
| Diagnosemethoden | – Audiometrie-Test: Wird eingesetzt, um die Hörsensibilität zu messen. – Tympanometrie: Bewertet die Funktion des Mittelohrs. – Otoakustische Emissionen (OAE): Überprüfen den Zustand der Haarzellen im Innenohr. |
| Behandlungsmethoden | – Bei dauerhaftem Hörverlust: • Hörgerät – Bei vorübergehendem Hörverlust: • Lärm meiden und das Ohr schonen |
| Präventionsmaßnahmen | – Lautstärke beim Gebrauch von Kopfhörern begrenzen (vorzugsweise unter 60 Dezibel, höchstens 60 % der maximalen Lautstärke) – Gehörschutz in lauten Umgebungen tragen (Ohrstöpsel oder Kapselgehörschutz) – Reduzierung der Dauer der Lärmexposition (längere Aufenthalte in lauten Umgebungen vermeiden) – Regelmäßige Hörtests (insbesondere für Personen, die in lauten Arbeitsumgebungen tätig sind) |
Was versteht man unter lärminduziertem Hörverlust?
Lärminduzierter Hörverlust ist eines der wesentlichen gesundheitlichen Probleme, die durch Industrialisierung und technologische Entwicklungen verursacht werden. Er kann durch langfristige, regelmäßige oder übermäßig hohe Lärmbelastung entstehen. Insbesondere bestimmte Berufsgruppen unterliegen einem höheren Risiko. Hörverlust tritt bei Personen, die in lauten Umgebungen arbeiten, häufiger auf.
- Zu den gefährdeten Berufen zählen unter anderem Bauarbeiter, Fabrikmitarbeiter, Flughafenpersonal, Militärangehörige, Musiker usw.
Chronische Lärmbelastung schädigt mit der Zeit die Hörnerven. Dadurch können neben dem Hörverlust auch weitere Gesundheitsprobleme auftreten. Zu den nicht-auditiven Auswirkungen gehören Schlafstörungen und ein hoher Stresspegel.
Staatliche Regulierungsbehörden haben verschiedene Vorschriften und Standards entwickelt, um die Lärmbelastung zu reduzieren. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Geräuschpegel am Arbeitsplatz zu kontrollieren und die Beschäftigten zu schützen. Der lärminduzierte Hörverlust lässt sich durch Früherkennung und regelmäßige Überwachung verhindern. In diesem Prozess ist es von großer Bedeutung, dass die Beschäftigten geschult werden und das Bewusstsein für dieses Thema steigt. Es gibt verschiedene Methoden, etwa Lärm an der Quelle zu mindern oder die Exposition der Beschäftigten zu reduzieren.
*Damit wir bestmöglich antworten können, empfehlen wir, alle Felder auszufüllen.
Was verursacht lärminduzierten Hörverlust?

Lärminduzierter Hörverlust ist ein gesundheitliches Problem, das durch Einwirkung hoher Schallpegel entsteht. Der Hörverlust hängt von verschiedenen Faktoren ab. Er kann vorübergehend oder dauerhaft sein und variiert in Abhängigkeit von der Lautstärke und der Einwirkdauer.
Berufliche Lärmbelastung:
- Bergwerke und Fabriken
- Gleisanlagen
- Baustellen
- Militärische Einrichtungen
Umweltbedingte Lärmbelastung:
- Autobahnen
- Züge und Flugzeuge
- Nachtclubs und Sportstadien
- Schießstände
Diese Einwirkungen können die Strukturen des Ohrs schädigen und das Hörvermögen beeinträchtigen. Besonders bei Langzeitexposition über 85 dB ist ein Hörverlust unvermeidlich. Mit steigender Lautstärke erhöht sich zudem die Wahrscheinlichkeit für einen bleibenden Hörverlust. Auch laute Musik oder plötzliche Schallereignisse wie Explosionen können erhebliche Hörschäden hervorrufen. Solche Schäden treten häufig abrupt auf und sind manchmal irreversibel.
Um einen lärminduzierten Hörverlust zu vermeiden, sind die Verringerung der Lärmbelastung und entsprechende Schutzmaßnahmen unumgänglich. Dazu ist eine bessere Sensibilisierung der Bevölkerung für diese Problematik erforderlich. Sowohl Individuen als auch Gesundheitseinrichtungen sind in der Verantwortung, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Gesundheit des Gehörs zu bewahren.
Wie häufig ist lärminduzierter Hörverlust?
Es ist schwierig, die genaue Prävalenz des lärminduzierten Hörverlustes (LIH) zu bestimmen, jedoch sind weltweit Millionen Menschen betroffen. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation ist insbesondere die jüngere Bevölkerung durch laute Musikquellen, zum Beispiel beim Freizeitverhalten, gefährdet. Betroffen sind vor allem Personen zwischen 12 und 35 Jahren. Außerdem ist LIH im beruflichen Kontext bei Männern öfter anzutreffen. Dieser Umstand wird zudem durch folgende Faktoren begünstigt:
- Niedriger sozioökonomischer Status
- Berufstätigkeit in konstant lauten Arbeitsumfeldern
Bei Frauen vermutet man hingegen, dass hormonelle Faktoren einen gewissen Schutz auf das Gehör ausüben könnten. Studien in den USA zeigen, dass etwa ein Fünftel der Erwachsenen mit Hörverlust von LIH betroffen ist. Damit ist LIH die zweithäufigste Berufskrankheit des Landes. Ohne entsprechende Vorsorge ist zu erwarten, dass diese Zahlen weiter steigen werden.
Was passiert im Ohr bei lärminduziertem Hörverlust?
Beim lärminduzierten Hörverlust laufen im Ohr mehrere biologische und mechanische Prozesse ab. Das Ohr fängt Schallwellen auf und wandelt diese in Nervenimpulse um, die an das Gehirn weitergeleitet werden. Dieser Vorgang beginnt im Außenohr und setzt sich bis ins Innenohr fort. Lärm stört diese natürlichen Abläufe und kann verschiedene Schäden verursachen.
- Das Außenohr sammelt die Schallwellen und leitet sie zum Mittelohr weiter. Der Gehörgang verstärkt Schall in einem bestimmten Frequenzbereich.
- Das Mittelohr wandelt Schallwellen in mechanische Energie um. Das Trommelfell und die Gehörknöchelchenkette sorgen dabei für eine Impedanzanpassung zur Weiterleitung des Schalls ins Innenohr.
- Im Innenohr werden die Schallwellen in Flüssigkeitsbewegungen umgewandelt. Diese Bewegungen versetzen die Basilarmembran in der Cochlea in Schwingung, die je nach Frequenz unterschiedliche Reaktionen hervorruft.
Die Cochlea ist das Organ, das die Schallwellen in elektrische Signale umwandelt und sie ans Gehirn weiterleitet. Durch Lärm können dabei verschiedene Schäden entstehen:
- Hohe Frequenzen schädigen verstärkt die basale Region der Cochlea, während tiefe Frequenzen eher die apikale Region betreffen.
- Starke Lautstärken erhöhen den Druck auf die inneren Haarzellen und können sie schädigen.
- Übermäßige Schallbelastung führt zu einer vermehrten Ausschüttung von Glutamat an den Synapsen der Haarzellen, was deren Zelltod begünstigen kann.
- Die Anhäufung reaktiver Sauerstoffspezies kann das Zell-DNA schädigen und damit einen irreversiblen Hörverlust verursachen.
Abhängig von der Intensität und Dauer der Lärmbelastung kann dieser Prozess zu vorübergehendem oder dauerhaftem Hörverlust führen:
- Vorübergehende Schwellenverschiebung: Tritt nach kurzer Einwirkung hoher Lautstärken auf und normalisiert sich meist innerhalb weniger Tage.
- Dauerhafte Schwellenverschiebung: Entsteht durch langfristige oder wiederholte Einwirkung lauter Geräusche und ist nicht umkehrbar.
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen und Terminvereinbarung!
In welchen Umgebungen kann lärminduzierter Hörverlust entstehen?
Ein lärminduzierter Hörverlust tritt vor allem in bestimmten Umgebungen vermehrt auf. Besonders Orte mit Pegeln, die das Trommelfell schädigen können, bergen ein hohes Risiko. Folglich sind einige Umgebungen besonders kritisch. Erstens stellen Arbeitsplätze wie Industrieanlagen und Baustellen mit hohem Geräuschpegel eine große Gefahr dar. Hier müssen Mitarbeitende zwingend Gehörschutz tragen.
Zudem ist Verkehrslärm in städtischen Gebieten eine bedeutende Lärmquelle. Personen, die in Gegenden mit hohem Verkehrsaufkommen leben, können bei dauerhafter Lärmbelastung Hörschäden erleiden. Entsprechend sollten auch sie Vorsichtsmaßnahmen treffen.
- Konzert- und Stadionveranstaltungen können sehr hohe Dezibelwerte aufweisen.
- Bars und Nachtclubs sind oft risikoreich wegen lauter Musik.
- Flughäfen und Bahnhöfe sind Beispiele für Verkehrsknotenpunkte, in denen permanent hohe Lautstärke herrscht.
Wie wird ein lärminduzierter Hörverlust diagnostiziert?
- Die Diagnose des lärminduzierten Hörverlustes (LIH) erfordert eine sorgfältige Untersuchung durch Hörakustiker oder Audiologen. Zunächst wird eine ausführliche Anamnese erhoben, um andere mögliche Ursachen des Hörverlustes auszuschließen. Anschließend werden spezifische audiologische Tests durchgeführt, um LIH zu bestätigen.
- Tonaudiometrie: Dieser Test liefert Informationen über die Frequenzen und Schwere des Hörverlustes. Besonders typisch für LIH ist eine Kerbe im Bereich von 3 bis 6 kHz. Diese Kerbe ist eine direkte Folge der Lärmbelastung. Abschließend wird der Hörverlustgrad wie folgt ermittelt:
- Man bestimmt die Hörschwellen bei 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz und 4 kHz in jedem Ohr.
- Dann wird der arithmetische Mittelwert dieser Werte berechnet.
- Sprachverstehen in Lärmsituationen: Dient dazu, die Wirksamkeit von Hörgeräten und die Fähigkeit, Sprache bei Hintergrundgeräuschen zu verstehen, zu bewerten.
- Sprachaudiometrie:
- Der Sprachaufnahme-Schwellenwert (SRT) kennzeichnet, ab welcher Lautstärke ein Patient Sprache wahrnehmen kann.
- Der Worterkennungsgrad (WR/SDS) zeigt, wie gut ein Patient Worte differenzieren kann.
Diese Tests sind entscheidend, um die Art und den Schweregrad des Hörverlustes festzustellen. Besonders niedrige SRT- und SDS-Werte bei ansonsten unauffälligen Audiogrammen können ein Frühzeichen von LIH sein.
- Otoakustische Emissionen (OAE): Sie werden herangezogen, um den Zustand der Cochlea objektiv zu beurteilen. Bei Verdacht auf LIH bieten OAE-Tests eine hohe Sensitivität und Spezifität.
- Hirnstammaudiometrie (BERA): Über die Analyse der auditorischen Hirnstammpotentiale kann eine mögliche Synaptopathie erkannt werden. Sie wird insbesondere zur Diagnose eines „Hidden Hearing Loss“ eingesetzt.
Wie wird lärminduzierter Hörverlust behandelt?
Die Behandlungsmöglichkeiten beim lärminduzierten Hörverlust sind aufgrund des derzeitigen technischen und medizinischen Wissens beschränkt. Da der Hörverlust irreversibel ist, konzentrieren sich die verfügbaren Maßnahmen auf das Management des Schadens. In erster Linie bieten Hörgeräte eine wesentliche Lösung für Menschen mit Hörverlust. Diese Geräte verstärken den Schall frequenzspezifisch, um den Hörverlust auszugleichen. Es gibt verschiedene Arten von Hörgeräten, die an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden können.
Insbesondere Personen, die unter lärmbedingtem Tinnitus (Ohrgeräuschen) leiden, können von Maskern oder einer Tinnitus-Retraining-Therapie (TRT) und Neuromodulationsansätzen profitieren. Masker überdecken das Ohrgeräusch, während TRT darauf abzielt, die neuronale Verbindung zwischen Ohr und Gehirn zu stärken.
Auch Magnesium und Vitamine haben in Tierexperimenten eine schützende Wirkung gegen Hörverlust gezeigt:
- Vitamin A,
- Vitamin E,
- Vitamin C,
- Vitamin B12.
Welche Komplikationen können bei lärminduziertem Hörverlust auftreten?
Der lärminduzierte Hörverlust kann nicht nur das Gehörsystem selbst, sondern auch den allgemeinen Gesundheitszustand beeinträchtigen. Eine permanente Lärmbelastung führt zu einem Anstieg der Stresshormone und kann Stoffwechselstörungen begünstigen. Langfristig erhöht dies das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zudem beeinträchtigen Schlafmangel und Erholungsdefizite die Arbeitsleistung und erhöhen das Unfallrisiko. Die psychologischen Folgen sollten ebenso wenig unterschätzt werden:
- Depression
- Angststörungen
- Konzentrationsmangel
- Zwischenmenschliche Spannungen
Wie kann man lärminduziertem Hörverlust vorbeugen?
Lärminduzierter Hörverlust ist vor allem in Arbeitsumgebungen mit hohen Schallpegeln ein häufig auftretendes Gesundheitsproblem. Dauerhaft hohe Dezibelwerte am Arbeitsplatz können das Gehör schädigen. Um dies zu verhindern, sind entsprechende Vorkehrungen von größter Bedeutung. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer sollten Maßnahmen ergreifen, um die Gesundheit des Gehörs zu schützen.
- Weniger häufig an lauten Veranstaltungen wie Konzerten oder Feuerwerksshows teilnehmen
- Orte mit bekannten hohen Schallpegeln meiden
- Auf das Musikhören bei hoher Lautstärke verzichten
- In lauten Arbeitsumgebungen Gehörschutz tragen
Sıkça Sorulan Sorular
Wo im Ohr tritt lärminduzierter Hörverlust auf?
Ein lärminduzierter Hörverlust entsteht durch die Schädigung des Innenohrs (Cochlea), wenn Menschen einer akuten oder chronisch hohen Lärmbelastung ausgesetzt sind. Dies kann sowohl vorübergehend als auch dauerhaft sein.
Die Cochlea ist das Organ, in dem die Auswertung des Gehörten beginnt. Sie ist mit Haarzellen ausgestattet, die Schallwellen in elektrische Signale umwandeln. Bei Lärmbelastung können diese Haarzellen beschädigt oder vollständig zerstört werden. Da sich die Haarzellen nicht regenerieren, ist ein dadurch verursachter Hörverlust irreversibel. Somit beruht der lärminduzierte Hörverlust hauptsächlich auf der Schädigung der Haarzellen in der Cochlea.
Kann sich ein lärminduzierter Hörverlust zurückbilden?
Der lärminduzierte Hörverlust steht in Zusammenhang mit Dauer und Intensität der Lärmbelastung. Zu Beginn kann dieser Hörverlust vorübergehend sein und sich innerhalb einiger Tage zurückbilden. Häufig fällt dabei ein Tinnitus stärker auf als die tatsächliche Hörminderung. Hauptauslöser sind das Besuchen von Unterhaltungsstätten und Konzerten, eine zu große Nähe zur Lärmquelle oder laute, plötzliche Geräuschexplosionen. Anfangs ist dieser Zustand eventuell reversibel, kann aber, wenn die betreffende Person weiterhin regelmäßig lauten Umgebungen ausgesetzt ist, chronisch werden.
Auch ein konstant hoher Lärmpegel, etwa bei beruflicher Lärmbelastung, kann mit der Zeit zu einem dauerhaften lärminduzierten Hörverlust führen. Wenn keine Schutzmaßnahmen ergriffen oder keine frühzeitigen Gegenmaßnahmen getroffen werden, ist eine Rückbildung dieses Hörverlustes nicht mehr möglich. Es gibt keine bekannte Therapie, die lärminduzierte Hörschäden beseitigen könnte; sie sind irreversibel. Die einzige Möglichkeit, die durch den Hörverlust verursachten Einschränkungen zu mindern, besteht in der Nutzung eines Hörgerätes.
Ab welcher Lautstärke verursacht Lärm einen Hörverlust?
Die Lautstärke, ab der Lärm einen Hörverlust hervorrufen kann, ist durch internationale Standards festgelegt. Nach diesen Richtlinien beginnt der kritische Bereich für das Gehör bei etwa 85 dB (Dezibel). Der Frequenzbereich dieser schädlichen Schallwellen umfasst ein breites Spektrum, sodass bei einer langfristigen Exposition gegenüber Werten über 85 dB ein Hörverlust auftreten kann. Deshalb sind Dauer und Intensität der Lärmbelastung entscheidend für den Erhalt des Hörvermögens.





